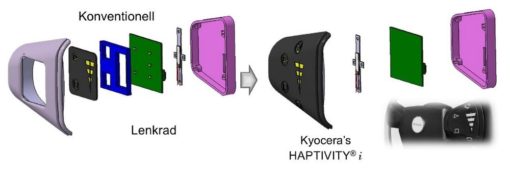Sollte ein Schutzzaun in das Schutzleitersystem der Maschine eingebunden werden? In bestimmten Fertigungsbereichen ist der Potentialausgleich bei der Konstruktion und dem Einsatz von Schutzeinrichtungen unerlässlich. Nur dann kann im Fehlerfall durch gesicherte automatische Abschaltung der Stromversorgung ein elektrischer Schlag für den Menschen verhindert werden. Die Entscheidung über die Erforderlichkeit im speziellen Falle liegt jedoch bei der Kundschaft selbst – im Austausch mit deren Elektrofachkraft im Rahmen der kundenseitigen Risiko- und Gefährdungsbeurteilung. Brühl kann unterstützend Empfehlungen geben und auch die notwendigen Mittel zur Ausführung zur Verfügung stellen. Wir fassen nachfolgend Normen und Begriffsdefinitionen zusammen, die Ihnen bei eingehender Beschäftigung mit dem Thema begegnen werden.
Was ist ein Schutzpotentialausgleich und warum ist er so wichtig?
Was ist ein Potential?
Ein Potential ist die Spannung (in Volt) zwischen einem Messpunkt und einem Bezugspunkt – wobei die Erdspannung, also das Erdpotential, für uns in der Regel den Bezugspunkt bildet.
Was ist ein Potentialausgleich?
Ein Potentialausgleich ist eine gute leitfähige Verbindung zwischen Punkten mit unterschiedlichen Spannungen/Potentialen – in unserem Fall einer Maschine und dem Schutzzaun. Die unterschiedliche elektrische Spannung zwischen den Körpern wird durch den Ausgleich auf das gleiche Potential (Niveau) gebracht.
siehe ↗ EN 60204-1:2018 3.1 Begriffe: „3.1.26 Potentialausgleich: Herstellen elektrischer Verbindungen zwischen leitfähigen Teilen, um Potentialgleichheit zu erzielen“
Wofür wird ein Potentialausgleich gebraucht?
Die ↗ EN 60204-1:2018 8.1 Potentialausgleich – Allgemeines unterscheidet den Potentialausgleich in zwei Arten: den Schutzpotentialausgleich und den Funktionspotentialausgleich. Ersterer schützt Personen an einer Maschine vor einem elektrischen Schlag im Fehlerfall.
siehe ↗ EN 60204-1:2018 3.1 Begriffe: „3.1.49 Schutzpotentialausgleich: zum Schutz gegen elektrischen Schlag"
Der Funktionspotentialausgleich dagegen ist für die Reduzierung der verschiedenen elektrischen Störeinflüsse zuständig und gewährleistet damit einen reibungslosen Betrieb. Wie der Name sagt, betrifft er die Funktion der Maschine und hat damit keinen Einfluss auf die in diesem Artikel betrachtete Schutzpotentialfunktion. In bestimmten Anwendungsfällen wie z. B. bei Stauben, bei wiederkehrenden Bewegungen von Teilen oder durch den Aufbau kritischer Magnetfelder für Elektronikkomponenten kann der Schutzpotentialausgleich gleichermaßen als Funktionspotentialausgleich dienen.
Schutzleiter, Erdung und Potentialausgleich: So funktioniert der Schutz im Fehlerfall
Wie wird ein Schutzpotentialausgleich erreicht?
Zum Ausgleich im Fehlerfall sind Schutzleiter dazu da, den Strom von berührbaren (Maschinen- oder Zaun-)Teilen in die Erde abzuleiten. Das wird damit gewährleistet, dass der Weg des Stromes durch den Schutzleiter aufgrund dessen Länge, Querschnitts und Materials einen geringeren Widerstand als ein potentiell gefährdeter Mensch aufweist.
Das Schutzleitersystem ist die Gesamtheit von Schutzleiter und (in unserem Fall) Maschine und Schutzzaun. Bei größeren Anlagen ist die Kombination von mehreren Schutzleitern notwendig, um an allen Punkten den Widerstand des Schutzleitersystems geringer als den des Menschen zu halten.
Auch Schutzpotentialausgleichsleiter sind Bestandteile des Schutzleitersystems, die fremde, nicht zur elektrischen Anlage gehörige leitfähige Teile untereinander verbinden.
siehe ↗ EN 60204-1;2018 3.1 Begriffe: „Der Schutzpotentialausgleich kann durch Schutzleiter, Schutzpotentialausgleichsleiter und leitende Verbindungen zwischen leitenden Teilen einer Maschine und ihrer elektrischen Ausrüstung erreicht werden.“ „3.1.51 Schutzleiter: Leiter, der einen Fehlerstrom vom Körper der elektrischen Ausrüstung zur Schutzleiter-Anschlussklemme (PE) ableitet“
„3.1.50 Schutzleitersystem: Schutzleiter und leitfähige Teile, die zum Schutz gegen elektrischen Schlag im Falle eines Isolationsfehlers miteinander verbunden sind“
Wie sollten Sicherheitsvorkehrungen im Fehlerfall optimal ablaufen?
Wenn elektrisch leitende Teile der Maschine und/oder des Schutzzaunes unbeabsichtigt spannungsführend werden, liegt ein Fehlerfall vor. Das kann zum Beispiel durch die beschädigte Isolierung einer Leitung der Maschine oder eines ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittels (z. B. einer Bohrmaschine) erfolgen. In diesem Fall wird der Fehlerstrom gefährdungsreduziert für den Menschen durch das Schutzleitersystems abgeführt und die Stromversorgung unterbrochen, da der Leitungsschutzschalter (ehem. Sicherung) auslöst. Ein erhöhter Berührungsschutz wird durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD, ehem. FI) ermöglicht. Für die Sicherstellung der Schutzfunktion des RCD-Schalters muss die Gesamtanlage ebenfalls vollständig in das Schutzleitersystem eingebunden werden.
Warum Schutzzäune Teil des Schutzleitersystems sein sollten – auch bei großem Abstand zur Maschine
Benötigen auch Schutzeinrichtungen einen Schutzpotentialausgleich?
Wir verweisen hier auf zwei Normen, die im Zusammenspiel aussagen, dass a) eine Schutzeinrichtung aus leitendem Werkstoff um eine elektrisch betriebene Maschine ein „fremdes leitfähiges Teil“ darstellt, welches b) in das Schutzleitersystem eingebunden werden muss.
zu a) Grundsätzlich ist die ↗ EN ISO 14120: 2016-05 Sicherheit von Maschinen – Trennende Schutzeinrichtungen in Anwendung zu bringen: „5.13 Trennende Schutzeinrichtung mit elektrischen leitenden Teilen: Wenn trennende Schutzeinrichtungen aus elektrisch leitenden Werkstoffen hergestellt sind und in elektrisch betriebenen Maschinen verwendet werden, müssen sie als ‚fremde leitfähige Teile der Maschine‘ nach ↗ EN 60204-1:2018, 8 betrachtet werden.“ Diese definieren sich dort im Begriffs-Kapitel folgendermaßen: „3.1.28 fremdes leitfähiges Teil: leitfähiges Teil, das nicht zur elektrischen Anlage gehört, dass jedoch ein elektrisches Potential, im Allgemeinen das einer lokalen Erde, einführen kann“
zu b) Nach ↗ EN 60204-1:2018, 8 Potentialausgleich, Bild 4 – Beispiel des Potentialausgleichs für die elektrische Ausrüstung einer Maschine, müssen fremde leitfähige Teile (also auch Schutzzäune), um Potentialgleichheit zu erlangen, in das Schutzleitersystem eingebunden werden, sofern sie im Abstand von ≤ 2,5 m zur Maschine aufgestellt sind. Innerhalb dieses Abstandes konnte eine Person mit ausgebreiteten Armen Maschine und leitfähiges Teil gleichzeitig berühren. (↗ Abb. 01)
Wann wird die Einbindung des Schutzzaunes an das Schutzleitersystem trotz ausreichendem Abstand zu der Maschine empfohlen?
Durch die Befestigung von aktiven elektrischen Elementen direkt am Schutzzaun (z. B. Sicherheitsschalter) oder durch die Verwendung von ortsveränderlichen Geräten in der Nähe des Schutzzaunes (wie z. B. Bohrmaschine) kann es durch Beschädigungen, Materialermüdung und mechanischer Beanspruchung zu Fehlerfällen kommen, die den Zaun unter Spannung setzen. Sollte laut ↗ EN 60204-1:2018 Anhang A (normativ) A1.1 die Spannungsführung dieser Geräte die Grenzwerte von 50 V (AC) oder 120 V (DC) überschreiten, ist die Einbindung des Schutzzaunes in das Schutzleitersystem erforderlich. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass diese Grenzwerte auch durch elektrostatische Aufladung des Zaunes (z. B. bei Widerstands- oder Induktionsschweißanlagen) erreicht werden können.
Technische Umsetzung: So werden Zaunanlagen normgerecht eingebunden
Wie wird die Einbindung eines Schutzzaunes in das Schutzleitersystem realisiert?
Für uns gibt es zwei grundverschiedene Möglichkeiten der Betrachtung und ihrer einhergehenden Ausführung (↗ Abb. 02):
a) Die Betrachtung das Schutzzaunes als Gefüge von Teilen: Jede Komponente des Schutzzauns wird als separates leitfähiges Teil betrachtet. Die Teile werden untereinander mit Schutzleitern verbunden und ins Schutzleitersystem eingebunden.
b) Betrachtung des Schutzzaunes als Einheit: In diesem Falle wird der gesamte Schutzzaun als EIN leitfähiges Teil betrachtet. Dies bedingt im Vorfeld, dass die Komponenten des Zaunes untereinander leitend sicher verbunden Diese Verbindung wird durch Schutzpotentialausgleichsleiter realisiert. Die Einbindung des Zaunes ins Schutzleitersystem der Maschine erfolgt wie gehabt durch Schutzleiter.
In welchen Intervallen muss ein Schutzzaun in das Schutzleitersystem eingebunden werden?
Die Häufigkeit der Einbindung des Schutzzaunes in das Maschinen- oder Erdpotential wird bestimmt durch die Höhe des elektrischen Widerstandes des Schutzleitersystems. Der Widerstand resultiert aus dessen Länge, dem Querschnitt und dem Werkstoff – ausgehend vom Berührungspunkt bis zur Schutzleiteranschlussklemme, der Erdung. An jeder Stelle des Zaunes muss gewährleistet sein, dass das Schutzleitersystem einen kleineren Widerstand aufweist als der berührende Mensch. In der Praxis erfolgt die Messung des Widerstandes und die Vorgabe der Menge der Einbindungspunkte durch eine Elektrofachkraft. Normativ wird ein höchstzulässiger Widerstand nicht vorgegeben. Der Körperwiderstand eines Menschen liegt im Bereich von mehreren hundert Ohm, je nach Weg durch den Körper. Um den Abfluss des Stromes durch den Menschen zu verhindern, muss das Schutzleitersystem diesen Wert – im Idealfall um ein Vielfaches – unterschreiten.
Türen, Kabelkanäle und entnehmbare Zaunfelder – so bleibt der Schutzleiterkreis geschlossen
Wie wird das Schutzleitersystem des Schutzzaunes unterbrechungsfrei sichergestellt?
Die Entnahme eines Zaunfeldes, z. B. für Wartungsarbeiten, darf nicht zur Unterbrechung des Schutzleitersystems führen – auch nicht kurzzeitig. Auch für Teilstücke des Schutzzauns muss die Funktion des Potentialausgleichs stetig gewährleistet sein, da die Gefahr eines Fehlerfalls anhaltend besteht.
siehe ↗ EN 60204-1:2018 8.2.3 Durchgängigkeit des Schutzleitersystems: „Wenn ein Teil aus irgendeinem Grund entfernt wird (z. B. routinemäßige Instandhaltung), darf das Schutzleitersystem für die anderen Teile nicht unterbrochen werden.“
Ist der Schutzzaun beispielsweise nur an einer Seite in das Schutzleitersystem eingebunden, wird durch die Entfernung eines Zaunfeldes die Verbindung zur restlichen Zaunstrecke unterbrochen. Eine zweiseitige Einbindung in das Schutzpotential der Maschine ist empfehlenswert. Sollte sich aus der kundenseitigen Risikobeurteilung ergeben, dass Zaunfelder an verschiedenen Stellen gleichzeitig entfernt werden sollen, ist ein entsprechendes Sicherheitskonzept auszuarbeiten.
Wie werden Türen in das Schutzleitersystem eingebunden?
Türen sind Teil des Schutzzaunes, sie dürfen durch ihre Öffnung nicht zur Unterbrechung des Schutzleitersystems fuhren. Daher ist die Einbindung der Tür (inkl. des Türflügels) beidseitig sicherzustellen.
Müssen am Schutzzaun montierte leitfähige Kabelkanale in das Schutzleitersystem eingebunden werden?
Ja, da dort auch Leiter mit hohen Spannungen verlaufen können.
Im industriellen Umfeld werden in Kabelkanälen nicht nur Leiter von Schutz- (SELV) und Funktionskleinspannungen (PELV, FELV) verlegt, sondern auch jene mit hohen elektrischen Leistungen und Spannungen. Daher ist eine Einbindung von Kabelkanälen in das Schutzleitersystem durch Schutzleiter oder Schutzpotentialausgleichsleiter aus Sicherheitsgründen zu empfehlen.
Kann oder muss die Funktionsfähigkeit des Schutzleitersystems geprüft werden?
Sowohl laut ↗ EU-Richtlinie 2009/104/EG (Betreibervorschrift) als auch zur Einhaltung der ↗ MRL 2006/42/EG (Herstellervorschrift) muss die Prüfung des Schutzleitersystems vor der ersten Inbetriebnahme entsprechend dem Stand der Technik mittels Messung des Widerstandes durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Während des Betriebes ist der Betreiber zuständig, die Prüfung in regelmäßigen Zeitabstanden durchführen zu lassen, ebenso nach Änderungen oder Instandsetzungen. Auf nationaler Ebene wurde dies in Deutschland durch die Betriebssicherheitsverordnung festgesetzt:
siehe ↗ Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) §6 (3) 1: „Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass (…) 3. alle verwendeten und erzeugten Energieformen und Materialien sicher zu- und abgeführt werden können.“
Welche Anforderungen gelten für Schutzleiter, Anschlusspunkte und Kennzeichnung?
Wie muss ein Schutzleiter konstruiert sein?
Die ↗ EN 60204-1:2018 gibt Empfehlungen zu Werkstoff, Querschnitt und Bauweise von Schutzleitern und Schutzpotentialausgleichsleitern: Ein Schutzleiter aus Kupfer muss mind. 2,5 mm² bzw. bei nicht ausreichendem mechanischen Schutz 4 mm² Querschnitt aufweisen. Im Detail werden Hinweise für die Berechnung oder Auswahl des Querschnittes zur Verfügung gestellt. Die Norm gibt zusätzlich einen Hinweis auf Ausnahmeregelungen für angeschlossene Teile, die u. U. als Schutzleiter verwendet werden dürfen. siehe ↗ EN 60204-1:2018, 8.2.2 Schutzleiter: „Kupferleiter sind vorzuziehen. Wenn ein anderer Leiterwerkstoff als Kupfer verwendet wird, darf sein elektrischer Widerstand je Längeneinheit nicht den des zulässigen Kupferleiters überschreiten. Der Querschnitt solcher Leiter darf aus Gründen der mechanischen Haltbarkeit nicht kleiner als 16 mm² sein. (…) Jeder Schutzleiter muss: Teil einer mehradrigen Leitung sein; oder gemeinsam mit den Außenleitern in einem Gehäuse sein; oder einen Querschnitt haben von mindestens 2,5 mm² Cu oder 16 mm² Al, wenn ein Schutz gegen mechanische Beschädigung vorgesehen ist; 4 mm² Cu oder 16 mm² Al, wenn ein Schutz gegen mechanische Beschädigung nicht vorgesehen ist. (…)“
Was zeichnet einen Schutzpotentialausgleichsleiter aus?
Dauerhaft leitfähige Verbindung, mechanisch und thermisch belastbar, identifizierbar durch Farbe, Symbol oder Buchstaben.
Schutzpotentialausgleichsleiter stellen zwischen fremden leitfähigen Teilen eine dauerhaft leitende Verbindung her. Dazu gibt es in den Normen keine klare Definition. Da sie als Teil des Schutzleitersystems fungieren, gilt folgende Bedingung: siehe ↗ EN 60204-1:2018, 8.2 Schutzleitersystem: „8.2.1 Allgemeines: Alle Teile des Schutzleitersystems müssen so ausgelegt sein, dass sie in der Lage sind, den höchsten thermischen und mechanischen Beanspruchungen durch Erdschluss-Ströme standzuhalten, die in dem jeweiligen Teil des Schutzleitersystems fließen könnten.“
Welche Vorgaben müssen Schutzleiter-Anschlusspunkte erfüllen?
Nur für diesen Zweck verwendbar, mechanisch gesichert, eindeutige Kennzeichnung und normgerechte Auslegung.
Der Schutzleiter-Anschlusspunkt ist in der Regel ein mechanisches Fügeelement, z. B. eine Schraubverbindung, die sich am leitfähigen Teil (z. B. Zaunpfosten, Maschine, Haupterdungsklemme …) befindet und die besonderen Anforderungen unterliegt. Diese werden in ↗ EN 60204-1:2018 ausführlich dargelegt. Schutzleiter-Anschlusspunkte dürfen für keine andere Funktion genutzt werden. siehe ↗ EN 60204-1 8.2.4 Schutzleiter-Anschlusspunkte: „Alle Schutzleiter müssen entsprechend 13.1.1 angeschlossen werden. Schutzleiter-Anschlusspunkte dürfen nicht für die Befestigung von z. B. Vorrichtungen oder Teilen verwendet werden.“ siehe ↗ EN 60204-1 8.2.4, 13.1.1: „Alle Anschlüsse, im Besonderen des Schutzleitersystems, müssen gegen Selbstlockern gesichert sein. Die Anschlussmittel müssen für den Querschnitt und die Art der anzuschließenden Leiter geeignet sein. Der Anschluss von zwei oder mehreren Leitern an eine Klemme ist nur dann zulässig, wenn die Klemmen für diesen Zweck ausgelegt sind. Jedoch darf nur ein Schutzleiter je Klemmenanschlusspunkt angeschlossen werden. (…)“
Wodurch sind Schutzleiter, Schutzleiter-Anschlusspunkte und Schutzpotentialausgleichsleiter identifizierbar?
Farbcodierung (Grün-Gelb), grafisches Symbol (IEC 60417-5019) oder Buchstabenkombination (PE oder PB).
Nach ↗ EN 60204-1 müssen diese leitenden, sicherheitsrelevanten Komponenten entweder farblich, durch ein grafisches Symbol oder durch eine Buchstabenkombination gekennzeichnet werden. siehe ↗ EN 60204-1 8.2.2 Schutzleiter: „Schutzleiter müssen entsprechend 13.2.2 identifizierbar sein.“ siehe ↗ EN 60204-1 13.2.2 Identifizierung des Schutzleiters/ Schutzpotentialausgleichsleiters: „Der Schutzleiter/Schutzpotentialausgleichsleiter muss sich durch Form, Anordnung, Kennzeichnung oder Farbe von anderen Leitern deutlich unterscheiden. Wenn die Identifizierung nur durch Farbe erfolgt, dann muss die Zweifarben-Kombination GRÜN–GELB über die gesamte Leiterlänge benutzt werden. (…) Jedoch müssen diese Leiter an den Enden oder an zugänglichen Orten eindeutig durch das graphische Symbol entsprechend IEC 60417-5019:2006-08 (↗ Abb. 04 a) oder mit den Buchstaben PE oder durch die Zweifarben-Kombination GRÜN–GELB identifizierbar sein. Ausnahme: Schutzpotentialausgleichsleiter können mit den Buchstaben PB und/oder mit dem Symbol entsprechend IEC 60417-5021:2002-10 (↗ Abb. 04 b) gekennzeichnet werden.“
Schützt nicht schon die Pulverbeschichtung eines Schutzzaunes gegen die Gefahr des elektrischen Schlags?
Die Pulverbeschichtung dient dem Korrosionsschutz und nicht als Isolationsschicht. Eine vollwertige Isolation kann bei einer Pulverbeschichtung nicht gewährleistet werden, da eine 100-prozentige Deckung der Beschichtung, z. B. am Drahtübergang, nicht garantiert werden kann.
Fazit: Sicherheit beginnt bei der Erdung – Schutzzäune richtig ins Schutzleitersystem einbinden
Für Brühl steht die Sicherheit im Vordergrund. Daher empfehlen wir die Einbindung der Schutzzaunsysteme in das Schutzleitersystem Ihrer Anlage. Wir können Ihnen sichere und rechtskonforme Gesamtlösungen zur Verfügung stellen. Sowohl die Verwendung von Schutzleitern als auch die Integration von Schutzpotentialausgleichsleitern in das Zaunsystem ist möglich, siehe dazu ↗ Abb. 05–09. Die hierfür anzuwendenden Rechtsvorschriften mit ↗ EN ISO 14120:2013, ↗ EN 60204-1:2018 und der ↗ Arbeitsmittelbenutzungsverordnung 2009/104/EG (in Deutschland ↗ BetrSichV) sind EU-weit verbindlich.
Unsere Produkte zum Thema Potentialausgleich finden Sie auf unserer Webseite: https://bruehl-safety.com/zubehoer-und-anbausysteme/
Die Brühl Safety GmbH produziert trennende Schutzeinrichtungen, vornehmlich für den Maschinen- und Anlagenbau. Hierzu entwickelt das Unternehmen Produkte, die präzise auf die geltenden Normen und spezifischen Erfordernisse der jeweiligen Maschinen abgestimmt sind. Zusammen mit der Brühl Safety Doors GmbH als Vertriebsgesellschaft für kraftbetätigte Maschinenschutztore und der Brühl Project GmbH für Sonderlösungen wird alles aus einer Hand angeboten.
Brühl Safety GmbH
Waldstraße 63 b
57250 Netphen
Telefon: +49 (2737) 5934-0
Telefax: +49 (2737) 5919-46
http://www.bruehl-safety.com/
Marketing
Telefon: +49 2737 5934-36
E-Mail: astrid.langenbach@bruehl-safety.com
![]()